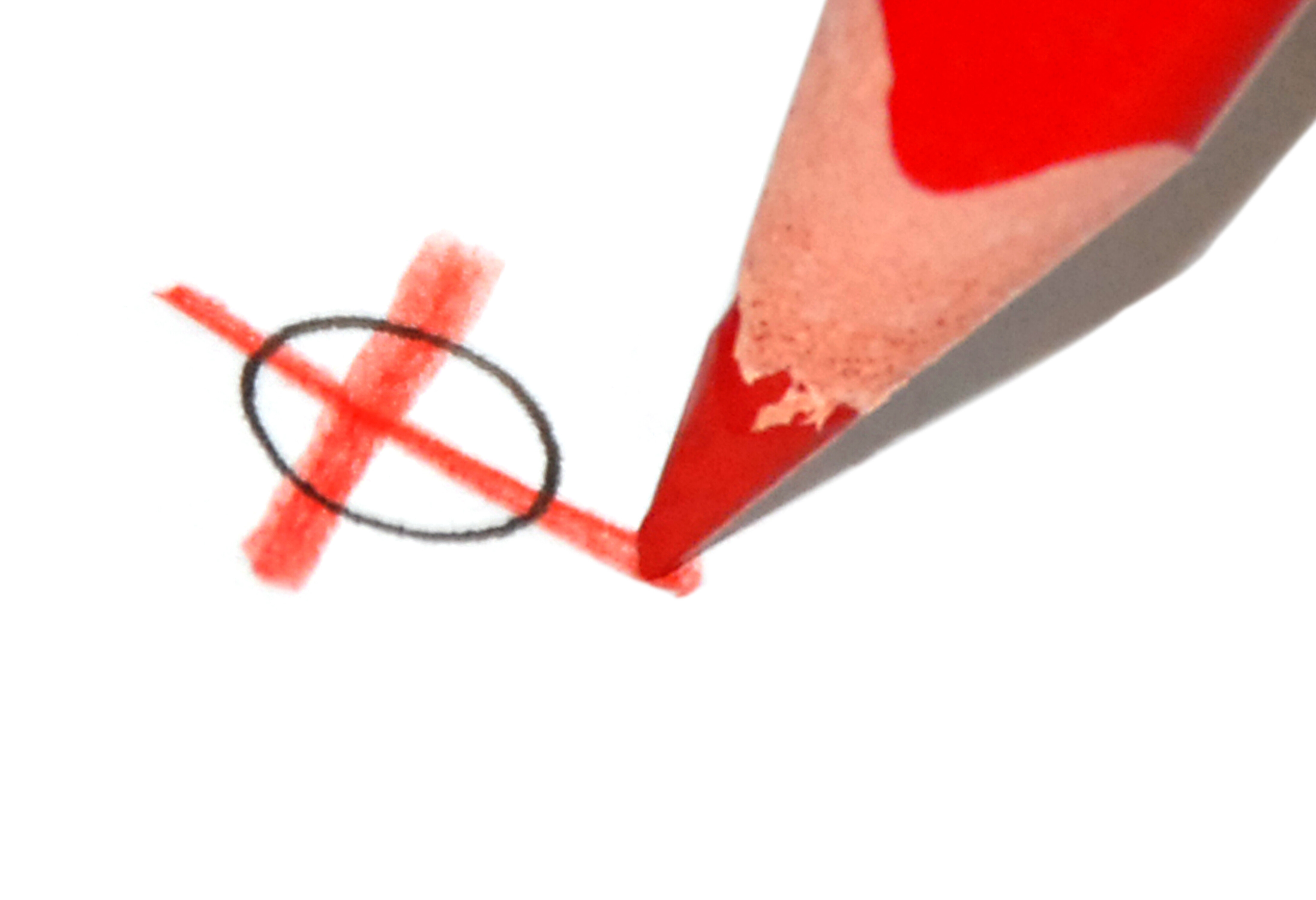Vorlage - 2017/188
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag von KTA Gödecke vom 06.06.2017:
Die Rückschnittmaßnahmen im Elbdeich-Vorland sind extrem auszuweiten, um das Abflussverhalten der Elbe bei Hochwasser zu verbessern
Sachlage:
Begründung:
Das wiederholte Stark-Regenfälle, im Einzugsgebiet der Elbe, ein katastrophales Hochwasser auslösen werden, ist aus Sicht vieler Bewohner in der Elbmarsch nur eine Frage der Zeit.
Die bislang erfolgten Rückschnittmaßnahmen werden für unzureichend erachtet.
Zumal jährlich mehr Busch nachwächst als zurückgeschnitten und gepflegt wird.
Die bisherigen Rückschnittmaßnahmen haben nur einen äußerst geringen Einfluss auf den Wasserabfluss der Elbe.
Nun will die Verwaltung den Schwerpunkt der Rückschnittmaßnahmen auf sogenannte „Engstellen“ im Deichvorland legen.
Doch das freischneiden von Engstellen an der Elbe ist so, als wenn man bei einer verstopften Dachrinne nur an zwei bis drei Stellen eine Handvoll (Laub u. Sand) herausnimmt - und das macht keinen Sinn“.
Bewohner der Elbmarsch, (die auch schon seit vielen Generationen am Fluss leben), sehen in der Verbuschung eine Gefahr für Leib und Leben.
So ist auch die neueste Resolution der Gemeinde Amt Neuhaus zu sehen.
„Der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus fordert, die Verbuschung durch massiven Gehölzrückschnitt, gezielte Rodung und durch Weidetiere endlich wirksam einzudämmen.
Es hat sich gezeigt, dass das Hochwasser im April 2006 einen um ca. 60 cm höheren Stand in Neu Darchau erreicht hatte, obwohl die Abflussmenge fast identisch war mit vergleichbaren Jahren.
Das die Hochwasser im Vergleich zu Vorjahren höher werden, steht in Verbindung mit der sogenannten Verbuschung und der dazugehörigen Ablagerung von Sedimenten. Das bestätigen zweifelsfrei die Untersuchungen von Fachleuten und NLWKN.
Erklärung zum gemeinsamen Vorgehen beim Hochwasserschutz an der Elbe sogenannte Absichtserklärungen und Gesetze gibt es zu genüge, u. a. folgende.
- Pressemitteilung ….. Die Grünen vom 30.05.17 dort heißt es:
„Zudem müsse der Sedimentation im Deichvorland entgegengewirkt werden“.
(Das man dazu die Verbuschung als Verursacher reduzieren muss, wird nicht erwähnt)
- Anfrage im Niedersächsischen Landtag Drucksache 17/1730 (Juli 2014) zu Ziffer 28 …. „Verbesserung des Abflussverhaltens der Elbe bei Hochwasser, durch Reduzierung des Bewuchses“.
- Gemeinsame Erklärung von Mecklenburg-Vorpom. und Niedersachsen aus dem Jahr 2012…Dort werde als Ziele verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Abflussverhaltens bei Hochwasser genannt: die Reduzierung des Bewuchses, die Abgrabung von Sedimenten sowie die Anlage von Flutrinnen.
- Den „Hochwasserschutzplan Niedersachsen, Untere Mittelelbe“. Verbuschung und Sedimentation stehen auch dort im Zusammenhang.
- Ferner das Wasserhaushaltsgesetz WHG (ein Bundesgesetz) hier insbesondere der §78 Abs. 1 Nr 7 dort heißt es,
in festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt: Das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen.
- Äußerst interessant ist auch der Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 92/43/EWG (mit seinen Ausnahmen) dort ist folgendes beschrieben:
Der Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie'
Es ist Sache der zuständigen einzelstaatlichen (untersten) Behörden, alternative Lösungen zu prüfen. ...
Laut Gemeinschaftsrecht sind „Gesundheit des Menschen“ und „öffentliche Sicherheit“ Gründe, mit denen die Annahme einzelstaatlicher Maßnahmen ..gerechtfertigt werden kann.
Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips ist es den zuständigen einzelstaatlichen Behörden überlassen zu überprüfen, ob eine solche Situation eintritt.
Selbstverständlich mag wohl jede derartige Situation von der Kommission im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kontrolle der richtigen Anwendung des Gemeinschaftsrechts untersucht werden.
(Anmerkung: Nach dem Subsidiaritätsprinzip soll eine (staatliche) Aufgabe soweit wie möglich von der unteren Ebene bzw. kleineren Einheit wahrgenommen werden. Die Europäische Gemeinschaft darf nur tätig werden, wenn die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichen und wenn die politischen Ziele besser auf der Gemeinschaftsebene erreicht werden können.)
Was den Begriff der „öffentlichen Sicherheit“ anbelangt, ist es zweckmäßig, auf das (u.a.) Urteil des Gerichtshofs vom 28. Februar 1991 in der Rechtssache C-57/89, Kommission gegen Deutschland („Deichanlage in der Leybucht“), zu verweisen.
Diese (Gerichts-) Entscheidung ging der Annahme der Richtlinie 92/43/EWG und somit Artikel 6 voraus. Die Gerichtsentscheidung ist jedoch nicht zuletzt deshalb weiterhin von Belang, weil der Ansatz des Gerichtshofs die Abfassung von Artikel 6 beeinflusste. Es ging hierbei um Bauarbeiten zur Deichverstärkung in der an der Nordseeküste gelegenen Leybucht. Diese Arbeiten gingen mit der flächenmäßigen Verkleinerung eines besonderen Schutzgebiets einher. Als eine der Grundsatzfragen legte der Gerichtshof dar, dass es sich bei den Gründen, die eine solche Verkleinerung rechtfertigen, um Gründe des Gemeinwohls handeln muss, die Vorrang vor den mit der Richtlinie verfolgten Umweltbelangen haben. Im konkreten Fall bestätigte der Gerichtshof, dass die Überschwemmungs-gefahr und der Küstenschutz ausreichend gewichtige Gründe seien, die die Maßnahmen zur Eindeichung und zur Verstärkung der Küstenanlagen rechtfertigten, solange sich diese Maßnahmen auf das Allernotwendigste beschränken.
Die einzelstaatlichen Behörden können die Verwirklichung eines Plans bzw. Projekts nur dann genehmigen, wenn das Vorliegen der genannten Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nachgewiesen werden kann, und dann auch nur in den Grenzen, in denen sich der betreffende Plan bzw. das betreffende Projekt als für die Erfüllung des fraglichen öffentlichen Interesses als notwendig erweist.
Das Problem ist zweifelsfrei erkannt, nur an einer konsequenten Umsetzung fehlt es zur Zeit.
Demnach bestünde durchaus die rechtliche Möglichkeit mehr zu tun. Und Nötigenfalls muss auch eine Klage hingenommen werden, wie das oben genannte erfolgreiche Beispiel zeigt.
Auch gibt es Hochwasserschutzrahmenpläne der Länder, dort stehen u. a. Folgende Themen im Fokus.
- Gefährdungs- und Schadenspotenzials eines Hochwassers
- Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der Schadenshöhe
- Gefahrenkarten
Jeder Bürger kann also sehen, wie stark er vom Hochwasser betroffen wäre und wie hoch das Wasser in seinem Haus stehen würde. (..die Konsequenz daraus - eine Elementarversicherung abzuschließen...)
Auch wurden neue Sandsack-Füllanlagen angeschafft und Warnsysteme eingeführt.
Ferner sind Umfluter oder gesteuerter Polder im Gespräch, die Umsetzungen würde aber 10 bis 15 Jahre dauern, wenn sie den überhaupt technisch umsetzbar wären.
Aber an der Ursache, die Verbuschung in Verbindung mit Sedimentation ändert das alles nichts. Der Busch wächst von Jahr zu Jahr und das Problem und die Gefahr wird immer größer.
Wissenschaftler warnen vor immer größeren Starkregenfällen und Überschwemmungen in Verbindung mit Hochwassern.
Die 2D-Modellierung
In der Berechnung der 2D-Modellierung im Anhang auf Seite 137 ist zu lesen: Eine Vegetation im Elbevorland, die ausschließlich aus Grasland besteht, würde gegenüber dem heutigen Zustand eine Wasserstands-Absenkung von bis zu 75 cm für HQ100 bewirken.
Die Umsetzbarkeit
Die Frage ist nun, ob dieser Ansatz (aus der 2D-Modellierung) aus Sicht der Politik und der Verwaltung grundsätzlich umgesetzt wird, bis andere Möglichkeiten machbar sind.
Sodass daraus ableitend die Rückschnittmaßnahmen im Elbdeich-Vorland extrem ausgeweitet und vorangetrieben werden, um das Abflussverhaltens der Elbe bei Hochwasser zu verbessern.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Gödecke
Sachdarstellung der Verwaltung, Stand 28.08.2017
Aus Sicht der Verwaltung wir zu dem Antrag wie folgt Stellung genommen:
Zunächst verweise ich auf die Stellungnahme zu Anfrage 2017/184.
Im Rahmen der 2-D-Modellierung der BfG wurden auch die Extremszenarien "nur Wald" und "nur Grünland" berechnet. Beide Szenarien dienen in erster Linie zur Modellüberprüfung und stellen unrealistische Zielsetzungen dar. Wie bereits in der Stellungnahme zur Anfrage 2017/184 ausgeführt, handelt es sich um besonders geschützte Bereiche, für deren Beseitigung entsprechende Kohärenzmaßnahmen durchzuführen wären. Auch wenn die Durchführung der Maßnahmen nationalem Recht unterliegt, ist Grundlage für die Regelungen zu den prioritären Lebensräumen die FFH-Richtlinie der EU. Die dort genannten Anforderungen sind ensprechend "abzuarbeiten", ansonsten droht ein Vertragsverletzungsverfahren.
Im Arbeitskreis Elbe, der sich mit den abflussverbessernden Maßnahmen an der unteren Mittelelbe beschäftigt, besteht Einigkeit, dass Gehölzrückschnitt eine von mehreren möglichen Maßnahmen für einen verbesserten Hochwasserschutz ist. Untersucht werden müssen aber auch Rückdeichungen, gesteuerte Polder und andere Maßnahmen. Auch die genannte Engstellenanalyse gehört dazu. Davon ausgehend, dass ein flächendeckender Rückschnitt rechtlich und auch in der Nachsorge nicht umsetzbar ist, ist es von großer Bedeutung, dass Gehölzbeseitigung dort stattfindet, wo es am effektivsten ist. Dies herauszufinden ist u.a. Aufgabe der weitergehenden Kooperation zwischen dem Land Niedersachsen und der BfG.
Um weiteren Rückschnitt in prioritären Lebensräumen durchführen zu können, wären die Anforderungen der FFH-Richtlinie bzw. des BNatSchG zu beachten. Zunächst wäre daher eine Verträglichkeitsuntersuchung durchzuführen, in deren Rahmen auch der Bedarf an Kohärenzmaßnahmen zu ermitteln wäre. Jeder Rückschnitt in prioritären Lebensräumen führt dazu, dass an anderer Stelle als Kohärenzmaßnahme eine gleichartiger Lebensraum neu begründet werden muss. Da dieser erst nach einem längeren Zeitrau die gleiche Qualität hat, wie der zu beseitigende Lebensraum, muss in der Regel sogar mehr Ersatz erfolgen als an anderer Stelle beseitigt wird. Bei den bereits in der Vergangenheit durchgeführten Rückschnittmaßnahmen hat sich gezeigt, dass die Suche nach geeigneten Ersatzflächen ein großes Problem darstellt. In größerem Umfang erfüllen nur andere Flächen im Elbvorland die Standortvoraussetzungen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, weshalb nur dort Rückschnittmaßnahmen umgesetzt werden, wo dies nachweislich eine nennenswerte Wirkung erzielt. Welche Flächen dies sind, wird im Arbeitskreis Elbe nach fachlichen Gesichtspunkten auf Grundlage der Berechnungen der BfG festgelegt.
Der Landkreis Lüneburg wirkt weiter im Arbeitskreis Elbe mit. Er wirkt in diesem Arbeitskreis darauf hin, dass die notwendigen umsetzbaren Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz umgesetzt werden. Hierzu gehört auch, dass in nachgewiesen hydraulisch deutlich wirksamen Bereichen ein Gehölzrückschnitt mit entsprechender Nachsorge erfolgt.