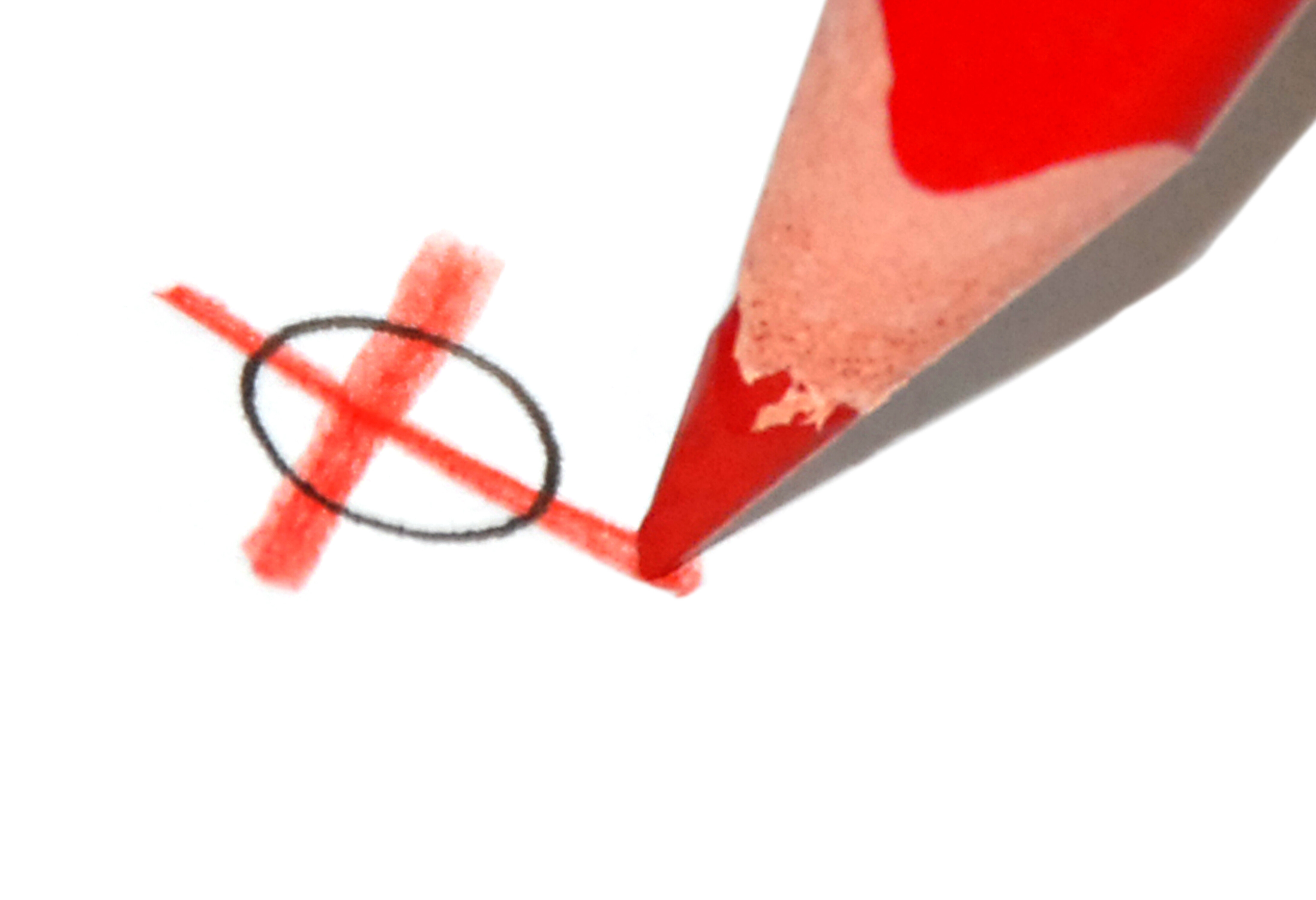Beschlussvorlage - 2021/015
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausschreibungsstrategie Zukunft ÖPNV/Mobilität Landkreis Lüneburg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 29.01.21)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Verwaltungsleitung
- Bearbeitung:
- Gülsün Hempelmann
- Verantwortlich:
- Krumböhmer, Jürgen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Mobilität
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
02.03.2021
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kreisausschuss
|
Entscheidung
|
|
Sachverhalt
Sachlage:
Der Kreistag des Landkreises Lüneburg hat 200.000 € für zwei Gutachten zur Verfügung gestellt. Ein Gutachten soll Modelle prüfen, in welcher rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Struktur der ÖPNV im Landkreis Lüneburg zukünftig betrieben werden soll (nachfolgend: Strukturgutachten). Neben dem Status Quo auf der Grundlage einer Allgemeinen Vorschrift kommen die Ausschreibung eines Verkehrsvertrages, die Gründung einer Fahrzeugvorhaltegesellschaft oder einer Verkehrsgesellschaft oder andere Varianten in Frage. Das zweite Gutachten soll sich mit der Weiterentwicklung der Mobilität, also dem Verkehrsangebot und der Bedienqualität in Anknüpfung an das Integrierte Mobilitätskonzept und den Nahverkehrsplan befassen (nachfolgend Mobilitätsgutachten).
Die Ausschreibung des Strukturgutachtens kann zeitnah begonnen werden. Die wesentlichen Inhalte eines Leistungsverzeichnisses liegen als Entwurf bei – Anlage 1. Voraussichtlich wird der Schwellenwert von 214.000 € für eine EU-weite Ausschreibung nicht erreicht, weshalb eine Unterschwellenvergabe in der Form einer beschränkten Ausschreibung vorgeschlagen wird. Die Verwaltung würde geeignete Beratungsunternehmen zur Abgabe von Angeboten auffordern. Die Angebote würden präsentiert und durch eine Kommission bewertet werden. Danach kann der Auftrag erteilt werden. Dieses Verfahren könnte bis Mitte 2020 abgeschlossen sein, sodass danach mit den Arbeiten begonnen werden könnte.
Die Verwaltung hat dieses Vorgehen am 05.01.2021 mit der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) besprochen. Ergebnis dieses Gesprächs ist der Vorschlag, das Strukturgutachten um zwei Elemente zu erweitern, um das weitere Verfahren effizienter zu machen.
Vorgesehen werden soll ein Zielfindungsverfahren. Der Kreistag hat am 16.11.2020 aufgrund der Vorlage 2020/370 bereits Grundsätze der Zieldefinition beschlossen. Für das weitere Verfahren ist eine belastbare Festlegung der Mobilitätsziele des Landkreises Lüneburg grundlegend für alle weiteren Schritte. Deshalb sollte dieser Schritt mit Unterstützung einer Fachberatungsgesellschaft mit den Beteiligten gründlich aufbereitet werden. Sie sollte somit über besondere Kompetenzen in der Moderation komplexer Verfahren verfügen.
Zu diesem Verfahrensschritt gehört schließlich auch die strategische Entscheidung für eine bestimmte Antriebstechnik. Solange die verschiedenen Möglichkeiten im Raum stehen, können alle weiteren Entscheidungen im Strukturgutachten nicht belastbar getroffen werden. Fahrzeugflotten mit bekannten Antrieben lassen sich ohne weiteres auf der Grundlage einer allgemeinen Vorschrift oder eines Verkehrsvertrages realisieren. Das gilt auch für Hybride aus Euro 6-Dieselmotoren und Elektroantrieben. Schon bei einer strategischen Entscheidung für batterieelektrische Antriebe ergeben sich zumindest mittel- und langfristig besondere Anforderungen bezüglich der Ladeinfrastruktur. Die Busflotte für den Landkreis Lüneburg umfasst ca. 150 Fahrzeuge vom 12m-Bus bis zum Gelenkbus mit drei Türen. Von dritter Seite werden von Subunternehmern weitere Fahrzeuge eingesetzt, wenn dies erforderlich ist. Die Fahrzeuge für das Rufbussystem und das ASM sind nicht mitgerechnet. Diese große Unterschiedlichkeit stellt besondere Anforderungen an die strategische Ausrichtung zur Antriebstechnik der Gesamtflotte.
Langfristig erfordert eine Flotte dieser Größe bei einem vollen oder überwiegenden batterieelektrischen Betrieb eine eigene Fläche als Betriebshof mit Wartung und vor allem mit einer ausreichend dimensionierten Landesinfrastruktur. Ein solches Vorhaben muss geplant werden, wobei das Energieversorgungsunternehmen die technischen Voraussetzungen schaffen muss.
Bei einer Entscheidung für Wasserstoffantriebe muss mit ähnlichem Vorlauf eine Tankstelleninfrastruktur mit den dazugehörigen langfristigen Lieferverträgen eingeplant werden.
In beiden Fällen ist eine Allgemeine Vorschrift wahrscheinlich keine ausreichende Rechtgrundlage, um Entwicklungen dieser Art anzustoßen. Auch bei einem Verkehrsvertrag würden sich zahlreiche Fragen stellen. Es ist nämlich zu beachten, dass in beiden Fällen zusätzliche öffentliche Mittel für die Investition und den Betrieb bereitzustellen sein könnten. Das kann beihilferechtlich Probleme bereiten.
Strategisch erscheint es für einen Landkreis der Größe des Landkreises Lüneburg schwierig zu sein, gleich mit einer Zahl von z.B. 150 Elektrobussen zu starten. Unabhängig von der Höhe der Investition und der damit erforderlichen Zuschüsse von staatlichen Stellen empfiehlt sich eine Durchmischung der Fahrzeugflotte, um in der Zukunft einen technologischen Wandel kontinuierlich durch teilweise Ersatzbeschaffungen nachvollziehen zu können.
Dies spricht für einen Start in einer gemischten Form, wobei allerdings bereits feststehen muss, in welche Richtung sich die Fahrzeugflotte entwickeln soll. Ein Strategiewechsel auf halbem Weg wäre ausgesprochen problematisch. Bereits die ersten Schritte sollten in die richtige Richtung gehen.
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, im Zuge des Strukturgutachtens noch in diesem Jahr eine grundsätzliche Entscheidung zur Antriebstechnik herbeizuführen. Eingeräumt wird, dass eine Festlegung dieser Art immer nur nach dem jeweiligen aktuellen Wissensstand möglich ist und deshalb Unsicherheiten bleiben werden. Dies wird sich aber in absehbarer Zukunft nicht ändern. Eine zeitliche Verschiebung dieser Entscheidung wird in den nächsten Jahren keine höhere Erkenntnissicherheit erbringen. Nicht zu befürworten ist ein Einstieg in die Nutzung alternativer, klimaneutraler Abtriebe, ohne die strategische Richtung definiert zu haben. Das gilt auch für die Option, Busse mit Elektromotoren zu bestellen und dabei einen späteren Austausch von Akkus gegen Brennstoffzellen zu erwägen, weil hierbei die Lade- und Tankstelleninfrastruktur mit den Werkstattkapazitäten doppelt finanziert werden müsste.
Hingewiesen wird auf das Verfahren zur Elbfähre bei Bleckede. Der Vertrag mit dem Projektsteuerer/ Bauherrnvertreter wird voraussichtlich demnächst abgeschlossen werden. In diesem Verfahren wird die Frage der richtigen Antriebstechnik ebenfalls am Anfang geklärt. Zwar unterscheiden sich die Prüfungen bezogen auf das Anforderungsprofil und die Dimension, einige Grundsätze werden jedoch gleich sein.
Das Strukturgutachten soll die strategische und technische Richtung vorgeben. Die konkreten Details würden einer separaten anschließenden Beratung vorbehalten bleiben, die sich nur auf die Variante beziehen würde, die ausgewählt worden sein wird.
Das Mobilitätsgutachten kann unter den vorstehend genannten Voraussetzungen abgesehen von der Zielfindung unabhängig von dem Strukturgutachten ausgeschrieben werden. Es würde auf dem Integrierten Mobilitätskonzept und dem Nahverkehrsplan aufbauen.
Die Verwaltung empfiehlt, mit erster Priorität das bisher Beschlossene umzusetzen. Dies gilt insbesondere für das Rufbussystem. Erst wenn der Nahverkehrsplan umgesetzt ist und eine Betriebszeit von ein bis zwei Jahren hat, ist eine fundierte Evaluation fachlich aussagekräftig. Davon unabhängig verzerrt die Corona-Epidemie zurzeit das Zahlenwerk. Es gibt noch viele weitere Projekte, die zur Umsetzung anstehen. Dies sind:
Reaktivierung Bahnstrecken Lüneburg-Bleckede und Lüneburg-Amelinghausen-Soltau, Konzept Bahnhof Embsen/Melbeck, Erweiterung ZOB Lüneburg, Umgestaltung Bahnhof Bardowick, Mobilstation Bahnhof Lüneburg, Einrichtung weiterer Mobilstationen, Barrierefreiheit von Haltestellen, Digitales Fahrgastinformationssystem, Ringlinie Innenstadt Lüneburg, Umsetzung Radverkehrskonzept mit drei kurzfristig anstehenden Maßnahmen im Nahbereich Lüneburg, Radschnellweg. Wahrscheinlich werden sich die Planungen im Zusammenhang mit Alpha E plus Bremen im Verlauf des Jahres 2021 konkretisieren. Diese Maßnahmen werden personelle Ressourcen binden.
Der neue Fachdienst Mobilität wird sich nach Personalwechseln in der ersten Jahreshälfte stabilisieren müssen.
Die Vorgabe eines Leistungsverzeichnisses für das Mobilitätsgutachten gestaltet sich nicht einfach. Im Nahverkehrsplan sind bereits viele Themen behandelt worden. Ein völliger Neustart ist nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll. Eine Analyse des Beschlossenen und der in der Mobilitätswelt aktuell diskutierten Themen legt nahe, dass im Schwerpunkt Themen betroffen sein werden, die sich um den Stadtverkehr Lüneburg und die weitere Flexibilisierung von Verkehren ranken. Dinge, die für die ländlichen Bereiche des Landkreises relevant sind, wurden durch den Rufbus, die Verstärkung der Regionallinien und das Radverkehrskonzept jedenfalls weitgehend bearbeitet.
Ein Fokus des Mobilitätsgutachtens wird auf einer Betrachtung liegen, wie durch Maßnahmen im und um das Stadtgebiet Lüneburg als Verkehrsknotenpunkt der Region eine Veränderung im Mobilitätsverhalten erreicht werden kann. Dabei kann auf die Zielsetzung, die im Strukturgutachten vereinbart werden wird, zurückgegriffen werden.
Zu beachten ist hierbei die besondere Rolle der Hansestadt Lüneburg. Richtig ist, dass alle Kommunen des Landkreises von dem Mobilitätsgutachten betroffen sein werden. Es handelt sich dabei aber um indirekte Effekte, soweit Bürgerinnen und Bürger aus den übrigen Kommunen des Landkreises die Infrastruktur in der Hansestadt Lüneburg nutzen. Die Hansestadt ist demgegenüber in eigenen Zuständigkeiten und Rechten betroffen, vornehmlich in der Stadtentwicklung, aber auch als Straßenbaulastträgerin, Grundstückseigentümerin oder Straßenverkehrsbehörde. Sie wäre für viele Maßnahmen Projektträgerin mit Finanzverantwortung. Vor diesem Hintergrund ist im neuen Finanzvertrag zwischen Landkreis und Hansestadt Lüneburg eine Zusammenarbeit vereinbart worden. Diese mündet in der Gründung eines gemeinsamen Mobilitätsgrundsatzausschusses.
Der Hansestadt Lüneburg sollte deshalb bei der Erstellung des Mobilitätsgutachtens eine besondere Rolle zugebilligt werden. Sie sollte neben der Abstimmung im Mobilitätsausschuss auch in den Arbeitsgremien vertreten sein. Dies würden die Verwaltungen regeln. Das Leistungsverzeichnis sollte mit der Hansestadt abgestimmt werden. Sie sollte auch in der Bewertungskommission zur Auswahl der Büros vertreten sein.
Hinsichtlich des Ausschreibungsverfahrens wird folgender Vorschlag gemacht. Vorsichtshalber sollte eine EU-weite öffentlich Ausschreibung durchgeführt werden. Dies kostet nicht wesentlich mehr Zeit, wird im Gegenzug aber keine Beschränkungen erzeugen, die später problematisch sein können.
Gewählt werden sollte ein Teilnahmewettbewerb. Die Situation im Landkreis Lüneburg würde beschrieben werden. Die Bieter würden aufgefordert werden, ein Konzept für ein Mobilitätsgutachten vorzulegen. Dies hat den Vorteil, dass die methodische Kompetenz der Bieter gefragt wäre. Vorgaben des Landkreises würden das Gesichtsfeld einengen. Gerade die Unterschiede in der Methodik mit den verschiedenen denkbaren inhaltlichen Vorschlägen und Instrumenten der Beteiligung können bereichern.
Abgefragt werden würde ein Konzept und die Referenzen des Teams. Dies und die Honorarhöhe würden in die Bewertung einfließen.
Zeitlich wäre die Vergabe so zu takten, dass die Arbeit mit dem Mobilitätsgutachten beginnen würde, wenn die Zieldefinition im Strukturgutachten abgeschlossen wäre. Das wäre deswegen gut zu erreichen, weil bei der Vergabe des Strukturgutachtens als beschränkte Ausschreibung kein Vorlauf in Form eines Teilnahmeverfahrens vorgesehen ist.
Ergebnis:
- Das bereits Beschlossene wird mit Priorität umgesetzt.
- Begonnen wird mit dem Strukturgutachten einschließlich Zielfindungsprozess und Vorschlag für eine Antriebstechnik auf der Basis einer beschränkten Ausschreibung.
- Zeitgleich zum Strukturgutachten um wenige Monate versetzt folgt das Mobilitätsgutachten als europaweite öffentliche Ausschreibung mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb.
- Nach Vorlage des Strukturgutachtens entscheidet der Kreistag über ein Vorzugsmodell für die zukünftige ÖPNV-Struktur verbunden mit der Antriebstechnik. Darauf aufsetzend werden die Details der Umsetzung geprüft.
Ergänzende Sachdarstellung vom 29.01.21:
Im Zusammenhang mit der Ausschreibungsstrategie sind Fragen zur politischen Beteiligung im Prozess aufgekommen. Die Verwaltung schlägt dazu vor:
In bewährter Form werden Vorsitzende und Stellvertreter des Mobilitätsausschusses an der Auswahl der Gutachter beteiligt. Sie nehmen an der Präsentation der Bieter teil und gehören der Auswahlkommission mit Stimmrecht an.
Die Ziele für die Mobilität werden vom Kreistag beschlossen. Die Ausarbeitung im Vorfeld liegt in der Hand des Mobilitätsausschusses. Er bedient sich dazu alternativer Formate, z.B. eines ganztägigen Workshops. Empfohlen wird, ein solches Format auch für den Verkehrsausschuss der Hansestadt zu öffnen. Damit würde praktisch auch der Mobilitätsgrundsatzausschuss einbezogen sein. Ob weitere Teilnehmer hinzugeladen werden, ist politisch zu entscheiden. Dies kann sinnvoll sein, wenn es um Kommunen, Verbände oder die VNO geht.
Auf jeden Fall sollte ein solches Format vom Gutachter des Strukturgutachtens vorbereitet und moderiert werden.
Ähnlich sollte die strategische Entscheidung für eine bestimmte Antriebstechnik ausfallen. Hier könnte die Entscheidung wegen ihrer Bedeutung ebenfalls im Kreistag getroffen werden.Die Vorbereitung wäre Sache des Mobilitätsausschusses. Vorgeschlagen wird, dass der Gutachter einen Vorschlag ausarbeitet. Dieser sollte in einem Symposium mit Fachexperten verteidigt werden. Daran schließt sich der Entscheidungsprozess über Fachausschuss, Kreisausschuss und Kreistag an. Da diese Entscheidung den Landkreis Lüneburg als ÖPNV-Aufgabenträger betrifft, ist eine Einbeziehung städtischer Gremien nicht unbedingt erforderlich.
Das Mobilitätsgutachten ist in der Fragestellung wesentlich offener. Erinnert wird an die Debatte zum IMK. Damals kam der Wunsch auf, schon zu jenem Verfahren alle Aspekte der Mobilität zu bearbeiten. Schließlich wurde der Fokus ÖPNV-Verbindungen und Radverkehr als Zubringer zum ÖPNV beschränkt. Vereinbart wurde aber auch, alle übrigen Themen zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Fortsetzung des IMK aufzugreifen. Dieser Zeitpunkt steht nun vor der Tür. Das Arbeitsprogramm sollte unterstützt durch einen Gutachter mit entsprechender Methodenkompetenz gemeinsam erarbeitet werden. Das ist ebenfalls hauptsächlich Aufgabe des Mobilitätsausschusses zusammen mit dem Mobilitätsgrundsatzausschuss.
In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss des Kreistages vom 15.06.2020 verwiesen, der lautet:
“Der Landrat wird beauftragt, eine Bewerbung als Modellregion für die Einführung eines 365-Euro-Tickets im Nahverkehr des Landkreises Lüneburg zu starten.“
Die Förderrichtlinie ist nun veröffentlicht. Unsere Beratungsfirma in Sachen Förderprogramme MCon führt dazu aus:
„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat nun die Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs“ sowie den entsprechenden Förderaufruf veröffentlicht (Gesamtbudget: 250 Mio. Euro). Hierüber hatten wir Sie vorab am 28.05.2020 informiert.“
Es gelten folgende Förderbedingungen:
Antragsberechtigte: Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im ÖPNV erbringen (auch Verbundprojekte)
Förderziele: Erreichen einer nachhaltigen Mobilitätswende weg vom motorisierten Individualverkehr – MIV - hin zu einem klimafreundlichen ÖPNV; Maßnahmen sollen dazu beitragen
- die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen
- die Nutzung des ÖPNV zu steigern
- die Verlagerung von Verkehren des MIV auf den ÖPNV zu erreichen
- die CO2-Emissionen des ÖPNV und des Verkehrssektors zu verringern
Förderfähige Maßnahmen: Alle Maßnahmen (auch Verknüpfung von Maßnahmen aus verschiedenen Bereichen), die dazu geeignet sind, die Förderziele zu erreichen:
- Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität (bspw. Taktverdichtungen, Entwicklung und Realisierung von On-demand-Diensten, Vorrang- und Beschleunigungsmaßnahmen, Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln); Förderhöchstbetrag: 10 Mio. Euro
- Entwicklung attraktiver Tarife (bspw. 365-Euro-Jahrestickets, Job-Tickets, innovative Tarif-/ Verbundangebote); Förderhöchstbetrag: 15 Mio. Euro
- Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen (bspw. Mobilitätsplattformen sowie deren Verknüpfung); Förderhöchstbetrag: 15 Mio. Euro
- Weitere Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV; Förderhöchstbetrag: 5 Mio. Euro
Fördersumme: Insgesamt max. 30 Mio. Euro pro Antragssteller (Förderhöchstsumme pro Maßnahmenbereich innerhalb eines Projekts siehe oben)
Fördersatz: max. 80 % (Kumulierung mit Landesfördermitteln auf bis zu 95% zulässig)
- Voraussetzungen (u. a.): Einbettung in ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität sowie Konzept, welches die verkehrliche, wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit der Maßnahmen auf nach Beendigung der Zuwendung sicherstellt und einen Beitrag zum Klimaschutz leistet
- Laufzeit: Projektabschluss bis spätestens 31. Dezember 2024
Antragsfrist in einem zweistufigen Verfahren ist zunächst der 29. März 2021 (Projektskizzeneinreichung). Anschließend werden vorausgewählte Antragsteller zur Vorlage förmlicher Förderanträge aufgefordert.
Nach derzeitigem Stand ist nicht klar, mit welchem Modell sich der Landkreis Lüneburg beteiligen könnte. Das Rufbussystem sollte zunächst wie beschlossen ausgebaut werden, bevor grundsätzliche Änderungen in Frage stehen. Die Ringlinie in der Innenstadt von Lüneburg kann nur gemeinsam mit der Hansestadt angegangen werden, was derzeit nicht ersichtlich ist. Verwaltungsseitig ist beim Bund angefragt worden, ob die Gutachten (Strukturgutachten und Mobilitätsgutachten) gefördert werden könnten. Dies würde evtl. zu einem längeren Prozess der Beantragung und Bewilligung führen.
Als Mitglied des HVV wird der Landkreis Lüneburg nicht von sich aus ein 365 €-Jahresticket einführen können. Wie bereits berichtet, durchläuft der HVV im Moment ein komplexes Verfahren zu Überprüfung der Tarifstruktur, dessen Ergebnisse noch nicht vorliegen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
18,9 kB
|