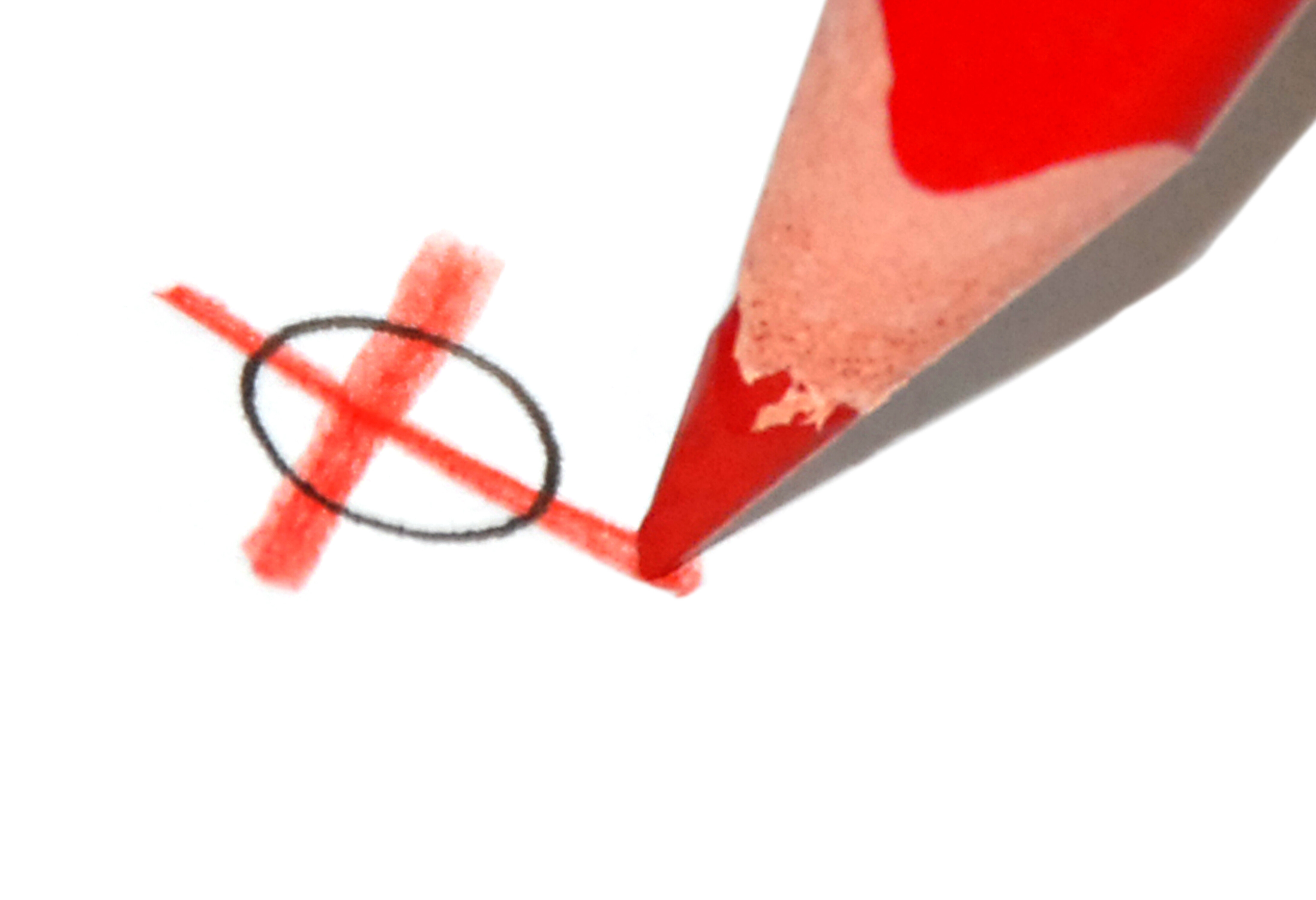Berichtsvorlage - 2010/181
Grunddaten
- Betreff:
-
Aktuelle Informationen zum Regionalprojekt Organisation der Sozialpsychiatrie im Landkreis Lüneburg (ROSLL)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- Verwaltungsleitung
- Bearbeitung:
- Martina Lüttchen
- Verantwortlich:
- Krumböhmer, Jürgen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
10.08.2010
|
Sachverhalt
Sachlage:
Auf den Bericht im Sozialausschuss am 05.02.2010 unter TOP 4 wird Bezug genommen.
Das Projekt ROSLL (Regionalprojekt Organisation der Sozialpsychiatrie im Landkreis Lüneburg) ist mit dem dritten Kreis der Akteure am 16.06.2010 abgeschlossen worden. Gegenstand des Prozesses war eine Verbesserung in der Sozialpsychiatrie im Landkreis Lüneburg. Der Landkreis ist hier als Träger des Sozialpsychiatrischen Dienstes und als Leistungsträger für die Eingliederungshilfe betroffen.
Der Kreistag hatte im Haushalt 2009 im Produkt Sozialpsychiatrischer Dienst unter Nr. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25.000 für den Prozess bereit gestellt. Daraufhin wurde Dr. Lauterbach aus Hannover als Moderator des Prozesses ausgewählt. Er hat diese Aufgabe mit seinem Kollegen, Herrn Bösterling, übernommen.
Der Prozess erhielt eine Projektstruktur mit einer Lenkungsgruppe, Expeditionsteams und Arbeitgruppen zu verschiedenen Prototypen. Zentral war der Kreis der Akteure mit bis zu 80 Personen, in dem alle Anbieter, die Psychiatrische Klinik Lüneburg, Kostenträger wie Sozialämter von Landkreis und Stadt Lüneburg, Krankenkassen und ARGE, Polizei und andere Stellen aus dem Landkreis Lüneburg - darunter alle Mitglieder des Sozialpsychiatrischen Verbundes - vertreten waren. Die Politik war durch Frau Stange und Frau Dziuba-Busch als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses vertreten.
Begonnen wurde der Prozess mit einem Auftakt im Kreis der Akteure am 26.08.2009. Im Verlauf des Prozesses wurden verschiedene Themenfelder ausgewählt, in Expeditionsgruppen erkundet und anschließend zu Prototypen verdichtet.
Behandelt wurden vier Prototypen:
· Hilfeplan und Koordination,
· Krisendienst,
· Arbeit und Übergänge,
· Gemeinsame Fortbildung.
Von aktuellem Interesse sind die ersten beiden Punkte. Das Hilfeplanverfahren hat zentrale Bedeutung bei der Entscheidungsfindung. Seit einigen Jahren werden Neufälle von ambulanten Hilfen in einer regelmäßig tagenden, mit gleichen Personen besetzten Hilfekonferenz besprochen. Das Verfahren hat sich eingespielt und prinzipiell bewährt. Es soll nun auf alle Eingliederungsfälle ausgedehnt und überarbeitet werden. So war das Verfahren bisher manchmal zu schwerfällig und die stationären Hilfen waren nicht erfasst.
Zukünftig sollen die Hilfekonferenzen - wie dies aus der Jugendhilfe bekannt ist - in jedem Einzelfall mit den jeweils betroffenen Personen oder Stellen besetzt werden. In geeigneten Fällen sollen Casemanager eingeschaltet werden. Dies soll anhand einiger Fälle praktisch erprobt werden. Vorgespräche mit Betreuungsverein und Justiz laufen.
Von dem neuen Hilfeplanverfahren werden eine schnellere Reaktion und eine hohe Qualität in der Entscheidungsfindung erwartet. Die Casemanager sollen in komplexen Fällen den Betroffenen unterstützen und ihn durch das Verfahren begleiten. Sie sollen auch über verschiedene Kostenträger und Lebensphasen hinweg eine kontinuierliche Begleitung sicherstellen. Dies kann der Einstieg in eine bessere Nutzung des persönlichen Budgets sein.
Der Krisendienst ist schon seit vielen Jahren eine Forderung der Anbieter, Betroffenen und Angehörigen. Zurzeit werden Fälle von Fremd- oder Eigengefährdung über das Kreisordnungsamt nach dem Niedersächsischen Psychisch-Kranken-Gesetz (NPsychKG) bearbeitet. Hier können psychische Krisen zu Zwangseinweisungen in die Psychiatrische Klinik Lüneburg (PKL) führen. Für einfache persönliche Krisen steht das Angebot der Telefonseelsorge zur Verfügung.
Im Falle psychiatrischer Krisen ohne Eigen- oder Fremdgefährdungen steht im Landkreis Lüneburg in den Abend- und Nachtstunden und an Wochenenden kein Angebot zur Verfügung. Betroffene und Angehörige haben so keine Stelle, an die sie sich wenden könnten. Sie müssen sich mit Notlösungen behelfen oder bleiben gänzlich ohne Hilfen.
Die Projektgruppe Krisendienst hat ein Konzept erarbeitet, das als Anlage 1 beigefügt ist.
Hierzu soll angemerkt werden:
1. Eine wissenschaftlich exakte Definition der Krise ist nicht erforderlich, weil in der Praxis aus möglichen unterschiedlichen Formulierungen keine Konsequenzen erwachsen.
2. Verwaltungsseitig ist mit der Feuerwehreinsatzleitzentrale (FEL) besprochen, dass deren Inanspruchnahme als ständig besetzte Stelle für erste Anrufe möglich ist. Vorgeschlagen wird aber, nicht die 112 als Telefonnummer zu verwenden, weil dies für Anrufer eine Hemmschwelle darstellen könnte. Eine andere, eingängige Telefonnummer würde eher die Akzeptanz der Betroffenen finden und könnte technisch auf die FEL geschaltet werden. Die Telefonnummer würde öffentlich bekannt gemacht werden. Die Disponenten der FEL würden die Anrufe entgegennehmen und prüfen, ob eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Bestätigt sich dies nicht, würde die FEL das Gespräch direkt an den Krisendienst weiterleiten.
3. Der Krisendienst hat die Aufgabe, die Situation zunächst am Telefon weiter zu erkunden und nach Möglichkeit eine Stabilisierung zu erreichen. Falls erforderlich wird ein Hausbesuch durchgeführt. Der Krisendienst spricht im Bedarfsfall eine Empfehlung für eine Kontaktaufnahme mit einem Dienst, z. B. DROBS, PKL, niedergelassener Arzt oder Sozialpsychiatrischer Dienst, aus.
4. Die empfohlenen Dienste werden vom Krisendienst sofort unterrichtet und sollten sich verpflichten, ein sofortiges Erstgespräch anzubieten.
5. Die Projektgruppe hat den Einsatz von ca. 26 Honorarkräften vorgeschlagen. Ohne eine verantwortliche, qualifizierte Leitung - ähnlich der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes - wird der Krisendienst nach Ansicht der Verwaltung nicht zu führen sein. Die Aufgabe des Krisendienstes verlangt standardisierte Qualitätsmerkmale, Falldokumentationen und ein Nachhalten der Einzelfälle, die den Krisendienst in Anspruch genommen haben. Diese Aufgaben müssen aus qualitativen und haftungsrechtlichen Gründen überwacht werden. Außerdem werden vielfältige logistische Fragen zu klären sein. Eine 0,25-Stelle in der Leitung wird erforderlich sein, um eine ärztliche Leitung des Krisendienstes zu gewährleisten.
6. Bewusst offen gelassen wurde die Trägerschaft des Krisendienstes.
· Zunächst könnte der Landkreis Lüneburg Träger des Krisendienstes werden. Dies wäre die am schnellsten umzusetzende Lösung. Sie legt die Verantwortung des Krisendienstes allein in die Hände des Landkreises.
· Der Landkreis Harburg beabsichtigt, seinen Krisendienst über einen eingetragenen Verein, in dem Privatpersonen Mitglieder sind, zu organisieren. Dies hat nach hiesiger Auffassung organisatorische und haftungsrechtliche Schwächen.
· Der Krisendienst könnte auch bei einer rechtsfähigen Gesellschaft angesiedelt werden. In diesem Fall könnte eine breite Beteiligung aller relevanten Leistungsanbieter und der Betroffenen sowie der Angehörigen möglich werden. Die Gesellschaft könnte weitere Angebote, wie z. B. eine frei zugängliche niederschwellige Beratung oder Soziotherapie, entwickeln. Auch über die Einrichtung eines Krisenbetts als Alternative zur Krankenhausunterbringung wäre nachzudenken. Die Gesellschaft hätte die Möglichkeit, Netzwerkgremien mit Entscheidungskompetenzen zu bilden. Schließlich könnte sogar der Einsatz der Casemanager über eine solche zentrale Stelle gesteuert werden. Die Finanzierung könnte durch Pauschalzuwendungen als Budget bei klarer Definition der Aufgaben erfolgen, sodass die Einzelentscheidungen innerhalb der Gesellschaft getroffen würden. Eine solche Lösung würde sehr effizient die Koordination in der regionalen Sozialpsychiatrie übernehmen können.
7. Die Honorarkräfte des Krisendienstes würden für ihre Tätigkeiten vom Träger vergütet werden. Dabei würde zunächst eine Bereitschaftsvergütung und im Falle des Einsatzes eine höhere Einsatzvergütung anfallen. Hierfür können im Jahr ca. 60.000 veranschlagt werden. Hinzu kämen ca. 15.000 für eine anteilige Leitung.
8. Nutznießer des Krisendienstes wären in erster Linie die Betroffenen und die Angehörigen. Aber auch die Krankenkassen würden Vorteile haben, weil im Landkreis Lüneburg besonders viele Zwangseinweisungen nach dem PsychKG anfallen und ein Krisendienst entlastend wirken würde. Schließlich würden die Stationen der PKL in der Nachtzeit und an Wochenenden durch direkte Anrufe ehemaliger Patienten, die sich nicht anders zu helfen wissen, weniger in Anspruch genommen.
9. Beabsichtigt ist, an die Krankenkassen mit der Bitte um Mitfinanzierung heranzutreten. Diesbezüglich wurde mit der wichtigsten Krankenkasse in diesem Bereich, der AOK, bereits Kontakt aufgenommen.
10. Ziel ist, den Krisendienst im Jahre 2011 zu starten. Bevor die Trägerfrage endgültig geklärt ist, könnte der Landkreis zunächst diese Rolle übernehmen. Ggf. könnte die Aufgabe später an eine Gesellschaft übertragen werden.
Für die weiteren Schritte werden bei der Mitfinanzierung des Krisendienstes und auch bei der Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens Kosten auf den Landkreis zukommen, über die im Zuge des Haushaltes 2011 zu beschließen sein wird. Die Verwaltung wird hierzu separat auf die Politik zukommen.
Unabhängig vom ROSLL-Prozess, aber in etwa zur gleichen Zeit haben Landkreis Lüneburg und PKL ihre Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe neu organisiert. Dabei geht es um den Übergang aus der Klinikbehandlung in die Eingliederungshilfe. Die Ergebnisse sind positiv.
Die Sozialpsychiatrie im Landkreis Lüneburg ist durch externe Einflüsse zeitlich parallel zum ROSLL-Prozess erheblich in Bewegung geraten.
Die AOK Niedersachsen hat landesweit durch eine Ausschreibung einen einzigen Anbieter mit der medizinischen Versorgung aller Menschen mit der Diagnose Schizophrenie beauftragt. Die Landkreise Lüneburg und Harburg sollen Modellgebiet sein. Durch diesen Auftrag ist mit der Entwicklung neuer ambulanter Strukturen in unserer Region zu rechnen. Einzelheiten können mündlich berichtet werden.
Die Leuphana-Universität hat im Innovationsinkubator ein Forschungsvorhaben zur Integrierten Versorgung psychisch Kranker angeschoben. Dies ist konzeptionell mit der Ausschreibung der AOK verwandt. Auch hierzu kann mündlich näher vorgetragen werden.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
38,8 kB
|