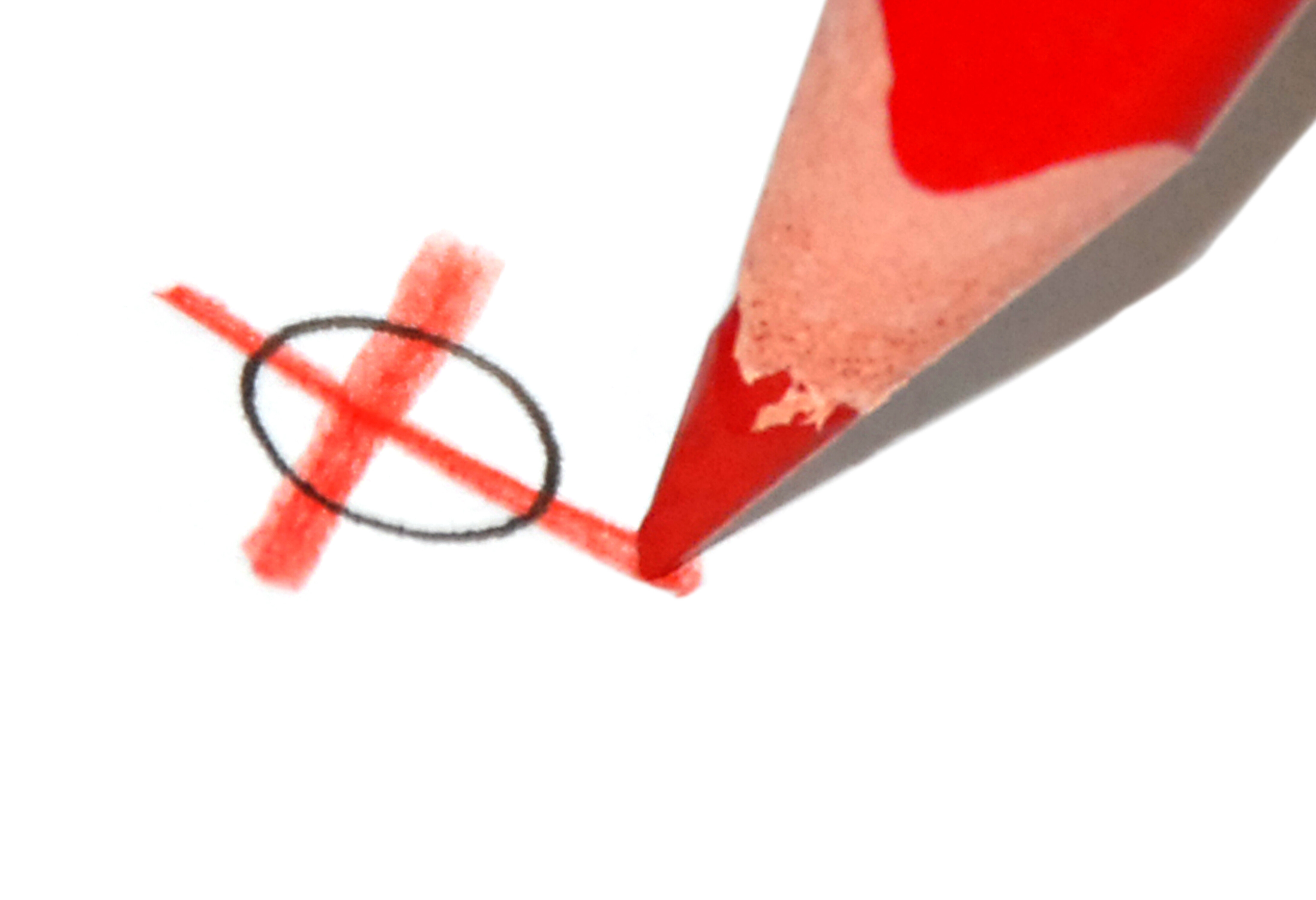Beschlussvorlage - 2020/370
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorlage Zukunft des ÖPNV im Landkreis Lüneburg
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bildung und Kultur
- Bearbeitung:
- Petra Lüdde
- Verantwortlich:
- Krumböhmer, Jürgen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Mobilität
|
Beratung
|
|
|
|
05.11.2020
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kreisausschuss
|
Beratung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag
|
Entscheidung
|
|
|
|
16.11.2020
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
- Nach Umsetzung des Nahverkehrsplans des Landkreises Lüneburg (Einführung aller Rufbusse mit Abstimmung Regionallinien) wird eine Evaluation durchgeführt. Die Methodik wird im Ausschuss für Mobilität besprochen.
- Der Landrat prüft rechtlich und betriebswirtschaftlich, welche Modelle mit welchen Vertragskonstruktionen am besten geeignet sind, moderne, nachhaltige Mobilität zukünftig umzusetzen. Wesentlicher Bestandteil der Modelle ist die konkrete Anpassung auf die Verhältnisse des Landkreises Lüneburg und eine fundierte Beschreibung der Implementierung des Modells ausgehend vom Status Quo. Er legt dem Kreistag ein Modell zur Beschlussfassung vor, wobei Vor- und Nachteile der Alternativen benannt werden.
- Der Landkreis Lüneburg entwickelt das Integrierte Mobilitätskonzept weiter (IMK 2.0).
- Die Arbeiten zu B und C werden fachlich extern durch zwei getrennte Aufträge begleitet. Dafür werden insgesamt brutto 200.000 € in den 2. Nachtragshaushalt 2020 des Landkreises Lüneburg eingesetzt.
- Der Landrat prüft, ob und welche öffentlichen Förderungen für die Punkte A-C möglich sind und stellt entsprechende Anträge.
- Ziele des Verfahrens nach B und C sind:
a) Betriebssicherheit
b) Klimaneutralität
c) Beförderungsqualität
d) Kosten für den Aufgabenträger
Der Betriebssicherheit kommt die höchste Priorität zu. Modelle, die keinen sicheren, weitestgehend störungsfreien Betrieb ermöglichen, sind nicht geeignet. Der Klimaneutralität kommt ebenfalls die höchste Priorität in dem Maße zu, wie die fortschreitende technische Entwicklung die Betriebssicherheit einer ganzen klimaneutralen Fahrzeugflotte ermöglicht. Die Beförderungsqualität verteilt sich auf viele Einzelaspekte, die z.T. eng mit der Betriebssicherheit und der Klimaneutralität verknüpft sind. Soweit dies der Fall ist, gebührt ihr hohe Priorität. Im Übrigen steht sie in einem Spannungsverhältnis zu den Kosten für den Aufgabenträger und muss im Einzelfall abgewogen werden. Der Landkreis Lüneburg ist aber bereit, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit finanzielle Lasten auf sich zu nehmen, um Techniken, die wegen geringer Stückzahlen trotz staatlicher Förderung noch keine geringen Kosten aufweisen, initial zu unterstützen.
Sachverhalt
Sachlage:
Diese Verwaltungsvorlage nimmt Bezug auf die Anträge der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke:
- 2019/430 Antrag der Fraktion SPD vom 30.11.2019 - Landkreis Lüneburg bewirbt sich als Modellregion für das 365 € Ticket
- 2020/212 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 23.06.2020 - NVP - E-Shuttle zwischen ZOB und Sande
- 2020/303 Antrag Fraktion Die Linke vom 03.09.2020 - Kommunalisierung des ÖPNV
- 2020/306 Antrag Fraktion SPD vom 04.09.2020 - Kommunalisierung des busbezogenen Öffentlichen Personenverkehrs im Landkreis Lüneburg
- 2020/307 Antrag Fraktion Die Linke vom 07.09.2020 – Alter der im ÖPNV eingesetzten Fahrzeuge
- 2020/316 Antrag Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 09.09.2020 - Fit in die mobile Zukunft im Landkreis Lüneburg
sowie auf die Verwaltungsvorlagen
- 2019/263 Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Ausschreibung von Verkehrsleistungen im Vergleich zur Allgemeinen Vorschrift
- 2019/302 Gründung Fahrzeugvorhaltegesellschaft
- 2020/335 Austausch mit der KVG zur Gesamtsituation im ÖPNV
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den Inhalt dieser Vorlagen verwiesen. Das gilt insbesondere für die Strukturen im ÖPNV und die Geschichte des bisherigen Prozesses. Zum Teil liegen zu den Vorlagen bereits Beschlüsse vor. Mit dieser Vorlage soll eine ganzheitliche Betrachtung des Gesamtthemas eröffnet werden, mit der alle bisher angesprochenen hiermit zusammenhängenden Punkte zusammengefasst werden.
Zu A Umsetzung Nahverkehrsplan und Evaluation
Verschiedene zeitliche Phasen sind zu unterscheiden. Was schnell umsetzbar ist, sollte ohne umfangreiche Prüfung angegangen werden. Deshalb arbeitet die Verwaltung weiter daran, den beschlossenen Nahverkehrsplan umzusetzen. Dies hat in den vergangenen Monaten Kraft und Zeit gekostet. Mittlerweile zeichnet sich ein Fortschritt bei der Umstellung ab. Es stehen aber noch Punkte aus, allen voran die flächendeckende Einführung des Rufbusses, die sich als aufwendig darstellt. Auch aus dem Radverkehrskonzept und dem Elektromobilitätskonzept ergeben sich Arbeitsaufträge. All diese Punkte sind –wie die Einführung des digitalen Fahrgastinformationssystems- abzuarbeiten. Die Anschaffung einer neuen Fähre, die Reaktivierung der Bahnstrecken und die Umgestaltung der Bahnhöfe Lüneburg und Bardowick stehen noch an. Die Barrierefreiheit der Haltestellen ist eine weitere Aufgabe. Neben diesen besonderen Herausforderungen ist das Alltagsgeschäft zu bewältigen, was insbesondere im Schülerverkehr von großer Bedeutung ist. Das wird die Verwaltung binden. Diese Themen sind nicht Gegenstand dieser Vorlage, sie haben aber Einfluss auf die Zeit- und Ressourcenplanung. Ohne eine weitere personelle Verstärkung drängt sich die Frage auf, welche Prioritäten bestehen. Die Verwaltung empfiehlt daher über eine weitere Stelle für 2021 nachzudenken. Die für den Radverkehr zusätzlich gedachte Stelle ist auf diesen Bereich beschränkt und wird kaum vor Sommer 2021 zur Verfügung stehen. Die neue Leitungsstelle wird nur zur Hälfte direkt in Projekten einzusetzen sein, weil auch Leitungsaufgaben anfallen.
Soweit sich kurz- oder mittelfristig Entscheidungsbedarf ergibt, wird dies entweder bei einfachen Dingen im laufenden Verwaltungsvollzug oder bei bedeutsamen Angelegenheiten mit dem Mobilitätsausschuss und ggfls. dem Kreisausschuss gelöst.
Sobald die bereits beschlossenen Maßnahmen umgesetzt sein werden, wird eine Evaluation des Nahverkehrsplans sinnvoll sein. Das bietet sich an, wenn die Rufbusse eingeführt sein werden. Dies geht praktisch mit einer Anpassung der Regionallinien einher. Derzeit erschwert die Corona-Epidemie eine Evaluation, weil die Nachfrage stark eingebrochen ist und keine auf Dauer realistischen Bedingungen gegeben sind. Im nächsten Jahr wird eine Evaluation hoffentlich begonnen werden können. Bis dahin bleibt ausreichend Zeit, die Methodik zu diskutieren. Die Evaluation kann im Kreis des Mobilitätsausschusses oder unterstützt durch externe Kräfte durchgeführt werden. Fachlich sinnvoll ist eine Evaluation aber erst, wenn das System insgesamt eingeführt ist und eine Zeit lang (ein Jahr) praktische Erfahrungen gesammelt werden konnten.
Zu B Prüfung Modelle Vertragskonstruktion
Rechtliche Betrachtungen stecken den Rahmen dessen ab, was möglich ist. Im Falle des ÖPNV werden Rahmen durch das Europarecht, das Personenbeförderungsgesetz und das Beihilferecht gesetzt. Hervorzuheben sind Vergaberecht und Steuerrecht, insbesondere die Umsatzsteuer.
Jedes Modell bedarf einer rechtlichen Form wie z.B. eines Vertrages (öffentlicher Dienstleistungsauftrag- ÖDA, einer Allgemeinen Vorschrift, eines Gesellschaftsvertrages usw.) alle diese Varianten sind in der Praxis vorzufinden und deshalb grundsätzlich lösbar.
Die Modelle müssen auch einer betriebswirtschaftlichen Prüfung standhalten können.
Der technische Fortschritt ist ein permanenter Prozess. Im ÖPNV entwickeln sich Antriebstechniken und digitale Kommunikation mit hoher Dynamik. Die Produkte sind noch nicht voll ausgereift. Daraus ergibt sich jedenfalls zurzeit noch ein Zielkonflikt zur Betriebssicherheit und zu den Kosten. So sind ausreichende Reichweiten in der Elektromobilität im ÖPNV und Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch nicht gesichert, wenn eine ganze Busflotte oder zumindest ein großer Teil kurzfristig auf neue Antriebstechniken umgestellt werden soll. Neue Antriebstechniken erfordern i.d.R. eine eigene Infrastruktur, wie Ladestationen mit Zuleitung, Tankstellen, Wartungseinheiten und geschultes Personal. Dies bei einer kleinen Anzahl von klimaneutralen Fahrzeugen vorzuhalten, ist wirtschaftlich nicht darstellbar.
Verschiedene Modelle sind in der Vorlage 2020/335 angerissen worden.
Die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beurteilungen könnten schon bis Ende 2021 vorliegen. In diese Prüfung würden der Vergleich zwischen allgemeiner Vorschrift und ÖDA sowie die Prüfung einer Fahrzeugvorhaltegesellschaft einbezogen werden. Der Auftrag wäre aber breiter und würde am Ende ein Gesamtbild ergeben. Entscheidend ist, dass nicht nur dargestellt wird, was theoretisch möglich ist. Hauptsächlich wird es um die konkrete Prüfung gehen, was anhand der Verhältnisse im Landkreis Lüneburg angestrebt werden soll und wie der Weg zum Ziel sicher gegangen werden kann.
Zu C Fortführung des Integrierten Mobilitätskonzepts
Die inhaltliche Fortführung des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMK 2.0) ist ein stark verkehrswissenschaftlich und verkehrspolitisches Vorhaben. Dies könnte in einer ähnlichen Methodik wie im ersten Verfahren geschehen also mit Beteiligung der Öffentlichkeit und der fachlich betroffenen Stellen. Nach Abschluss dieses Verfahrens sollte der Nahverkehrsplan mit Kreistagsbeschluss angepasst werden. In dem Verfahren würden die bisherigen Schritte bewertet werden. Dies ist zwar durch die Corona-Epidemie erschwert, ist aber trotzdem erforderlich.
Die strukturelle zukünftige Aufstellung im ÖPNV des Landkreises Lüneburg ist eng damit verknüpft, wie ein IMK 2.0 am besten in der Zukunft real umgesetzt werden kann. Je nach den Vorgaben sind die Anforderungen an das beste Modell mit der dazugehörigen Vertragskonstruktion unterschiedlich.
Insbesondere das Ziel Bedienqualität kann unter einzelnen Aspekten zu Konflikten mit klassischen Nutzern des MIV führen. Schließlich zielt dieses Thema direkt auf eine Reduzierung des MIV ab. Gerade die bekannten Musterkommunen konnten ihre Erfolge nur erreichen, weil sie die politische Kraft aufgebracht haben, den MIV aus Innenstädten herauszuhalten oder ihn fühlbar zu reduzieren. Das hat Jahre gedauert.
Dies ist bezüglich des benachbarten Themas des Radverkehrs oft nicht anders, wenn das Primat des MIV infrage gestellt wird.
Umsetzungsstrategien funktionieren oft nur oder zumindest wesentlich besser, wenn sie koordiniert sind. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten ruhen aber auf vielen Schultern: Land (mit Landesnahverkehrsgesellschaft, Schienenregionalverkehr, Bundes- und Landesstraßen) Landkreise (ÖPNV, Schülerverkehr und Schulen, Straßenverkehrsamt, Kreisstraßen untere Landesplanungsbehörde), Kommunen (Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Gemeindestraßen, Schulen). Daraus können sich praktische Schwierigkeiten ergeben.
Die Arbeiten an der Fortführung des IMK und an der Suche einer zukünftigen Struktur können in getrennten Verfahren vorangetrieben werden. Eine externe Begleitung ist notwendig.
Die Begleitung der Prozesse liegt beim Mobilitätsausschuss. Falls es sich im Verlauf der Arbeiten als sinnvoll erweist, kann der Mobilitätsausschuss einen Arbeitskreis zu seiner Unterstützung einrichten.
Die Arbeiten sollten in 2021 beginnen. Die Vorbereitung der Ausschreibung der fachlichen Begleitung sollte schon in 2020 starten.
Die inhaltliche Seite müsste unbedingt mit den Projekten der Hansestadt Lüneburg (Zukunftsstadt und nachhaltiger Mobilitätsplan) verschränkt werden. Deshalb sind verschiedene Gespräche erforderlich. Aussagen zum Zeitplan und genauem Leistungsverzeichnis sind im Moment schwierig. Allerdings ist aus einem anderen Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit in Verkehrsfragen zwischen Landkreis und Hansestadt Lüneburg ein gemeinsames Anliegen.
Zu D und E Finanzierung und Förderung
Die externe Begleitung zu B und C wird Geld kosten. Genauere Angaben können erst nach weiteren Gesprächen gemacht werden. Zunächst sollte mit 200.000 € gestartet werden. Möglichkeiten einer Förderung sind zu prüfen.
Zu F Zielsetzungen
Soll ein zukünftiger Weg festgelegt werden, ist zunächst zu vereinbaren, welche Ziele angestrebt werden. Ziele können sich wechselseitig bedingen, verstärken oder widersprechen; sie können auch neutral zueinanderstehen. Widersprechen sich Ziele sind Prioritäten zu vergeben. Dabei kann ein Ziel ein anderes verdrängen. Möglich sind jedoch auch Kompromisse. Zielerreichungsgrade unter 100 % können in solchen Fällen in der Gesamtbetrachtung ein Optimum ergeben.
- Betriebssicherheit
Grundelement des ÖPNV ist nach Ansicht der Verwaltung die Betriebssicherheit. Die Kunden erwarten die Einhaltung des Fahrplans. Erhebliche Abweichungen stellen die Akzeptanz des ganzen Systems in Frage.
- Klimaneutralität
Vermeidung von CO²-Ausstoß ist gerade im Verkehrssektor von hoher Priorität. Das bezieht sich nicht nur auf die Antriebstechnik im ÖPNV, sondern in einem mindestens gleichwertigen Maß auf die Vermeidung eines motorisierten Individualverkehrs (MIV) soweit er auf Verbrennungsmotoren beruht.
Nach Einschätzung der Verwaltung sind Aspekt des Klimaschutzes bei allen Maßnahmen mit strategischer und somit langfristiger Wirkung zunehmend immer weniger kompromissfähig.
- Beförderungsqualität
ÖPNV wird stärker genutzt, wenn er eine echte oder vielleicht sogar bessere Alternative zum MIV ist. Dies ist ein vielschichtiges Thema. Es geht um
- Qualität des Busse (bequeme Sitze, Klimaanlage)
- Verfügbarkeit von Sitzplätzen
- Taktzeiten
- Serviceangebot (Fahrpersonal, Leitstelle)
- Verknüpfung der Verkehrsmittel (z.B. Abstimmung von Bus und Bahn)
- Bedienzeiten (nachts, Wochenenden, Verbindung zum ASM)
- Beförderungszeiten im Vergleich zum MIV (Busbeschleunigung)
- Flächenerschließung (Rufbusse, Bürgerbusse)
- Barrierefreiheit
- Tarife (Kostenvergleich mit dem MIV)
- An- und Abreizsysteme (Bevorzugung des ÖPNV, Kosten für Parkplätze, autofreie Innenstadt)
- Begleitende Infrastruktur (Bushaltestellen, Mobilitätsstationen, digitale Informations-, Kommunikations- und Buchungsmöglichkeiten)
- Verkehrssicherheit
Die vorstehenden Aspekte sind grundsätzlich der Abwägung zugänglich. Insbesondere wegen des engen Zusammenhangs mit der Vermeidung der Nutzung des MIV mit Verbrennungsmotoren sollten zukünftige Anstrengungen ihr Betätigungsfeld in diesem Umfeld suchen.
- Kosten des Aufgabenträgers
ÖPNV muss auch bezahlt werden. Dies ist ein Kriterium, dass seiner Natur nach immer der Abwägung unterliegt. Es muss eine Einschätzung und Bewertung des Bedarfs und der Wirksamkeit der eingesetzten Mittel stattfinden.
- Prioritäten
Die Betriebssicherheit ist nach Ansicht der Verwaltung nicht einzuschränken. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist auch die Klimaneutralität nicht einzuschränken. Das kann auf einen Zielkonflikt mit der Betriebssicherheit hinauslaufen, wenn eine ganze Fahrzeugflotte sofort auf klimaneutrale Antriebe umgestellt werden soll. Praktisch wird es um einen realistischen Stufenplan einer zeitlichen Umstellungsstrategie gehen, um beide Ziele zu harmonisieren. Soweit die Beförderungsqualität Menschen dazu bewegt, auf den MIV zu verzichten, werden ebenfalls Klimaziele erreicht. Das gelingt aber nur, wenn das Angebot akzeptabel –also z.B. betriebssicher – ist. Die Aspekte haben keine unmittelbar messbare Wirkung; sie sind mit den Kosten abzuwägen. Der Einsatz finanzieller Mittel muss mit allen Belangen eines Landkreises abgewogen werden. Eine Nutzen-Kosten-Betrachtung hat in der Regel stattzufinden.