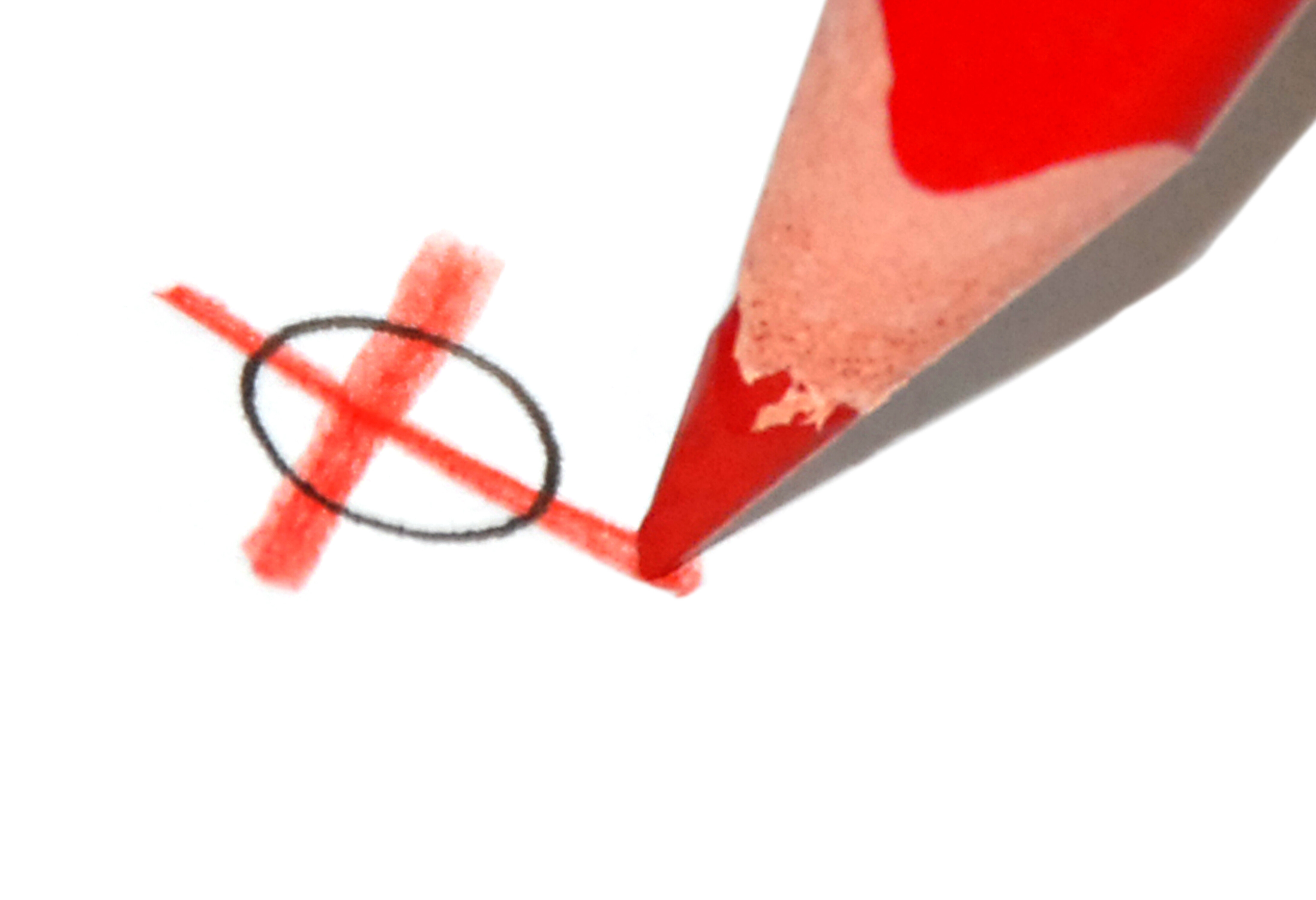Beschlussvorlage - 2009/114
Grunddaten
- Betreff:
-
Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms; Zustimmung zum Entwurf
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bauen
- Bearbeitung:
- Karin Schiemann
- Verantwortlich:
- Kalliefe, Burkhard
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
27.05.2009
| |||
|
|
18.06.2009
| |||
|
●
Gestoppt
|
|
Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
|
Beratung
|
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss stimmt der Vorlage der Verwaltung für den Entwurf
zur Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2003 (RROP) zu. Er bittet die
Verwaltung, die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.
Aktualisierter
Beschlussvorschlag vom 27.05.2009:
Der Ausschuss stimmt den Grundzügen der Vorlage der Verwaltung
für den Entwurf zur Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2003 (RROP)
zu. Er bittet die Verwaltung, die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen.
Sachverhalt
Sachlage:
Unmittelbar nach
Inkrafttreten des geänderten Landesraumordnungsprogramms (LROP) im Februar 2008
hat der Kreistag nach Beratung im Raumordnungsausschuss durch Beschluss vom
05.05.2008 das Verfahren zur Änderung/Fortschreibung des RROP 2003
eingeleitet (vgl. Beschlussvorlage
2008/017). Damit ist der Landkreis Lüneburg als einer der ersten Landkreise
Niedersachsens der Verpflichtung nach § 8 Abs. 3 des Nds. Raumordnungsgesetzes
(NROG) nachgekommen, ihre Regionalpläne an die Ziele des LROP anzupassen.
Bekannt gemacht wurden die Planungsabsichten gem. § 5 Abs.1 NROG
am 06.05.2008 im Amtsblatt. Mit der Anlage 1 legt die Verwaltung
nun den Entwurf zur Änderung/Fortschreibung vor.
Wie in der o.g.
Vorlage dargestellt, handelt es sich bei
dieser Fortschreibung um eine Änderung i. S. des
§ 9 NROG. Diese
Fortschreibung ändert das Programm allerdings nicht nur punktuell, sondern
- sie umfasst das gesamte Kreisgebiet und
- sie betrifft, wie in den
Planungsabsichten dokumentiert, eine Reihe von unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese sind:
- Zentralörtliche Funktionen,
Siedlungsentwicklung
- Entwicklungsaufgaben für Gemeinden und
Ortsteile (Gewerbe, Fremdenverkehr, Erholung u. a.)
- Verkehrsinfrastruktur einschließlich
Logistik,
- Gewerbe und Tourismus,
- Naturschutz, soweit es das Netz NATURA
2000 betrifft,
- Erholung (in Teilaspekten),
- Hochwasserschutz sowie
- Klimaschutz
Nicht geändert wurden folgende Inhalte:
- Landschaft, Biotopvernetzung und
Freiraumverbund,
- Grundwasser
- Land- und Forstwirtschaft
- Rohstoffsicherung
- Abfallwirtschaft
Maßgeblich dafür,
diese Inhalte zunächst nicht zu ändern, sondern einer in den nächsten Jahren
anstehenden Neuaufstellung vorzubehalten, war die Tatsache, dass die im
derzeitig gültigen RROP enthaltenen Ziele und Grundsätze, was die überörtliche,
raumordnerische Ebene und die Steuerungswirkung betrifft, durchaus noch aktuell
sind.
Erstmalig ist zu
diesem Entwurf auch, wie im neuen NROG geregelt, eine sogenannte
„Strategische Umweltprüfung (SUP)“ durchzuführen. Erstmalig wird
auch die allgemeine Öffentlichkeit an der Änderung des RROP beteiligt. Beide
Regelungen sind zurückzuführen auf entsprechende Vorgaben der Europäischen
Union.
Der Umweltbericht,
der die SUP dokumentiert, ist in wesentlichen Teilen von der Planungsgruppe
Umwelt, Hannover, in den übrigen Teilen im eigenen Hause erstellt worden und
als Anlage 2 beigefügt. Er beschreibt und bewertet die Auswirkungen von
textlichen und zeichnerischen Zielen und Grundsätzen auf die Umwelt. Dies
geschieht umso detaillierter, je räumlich konkreter oder verbindlicher die
einzelnen geänderten/ergänzten Festlegungen sind. Dabei betrachtet er sowohl
positive als auch negative Wirkungen und gibt allgemeine Empfehlungen, wie Letztere
vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden können. Dies geschieht
allerdings nur in einer Tiefe und einem Umfang, wie es der groben Maßstabsebene
1: 50.000 entspricht. Nähere, feinere Prüfungen sind den jeweils nachfolgenden
Planungsebenen vorbehalten, wie insbesondere der Bauleitplanung oder der
Planfeststellung.
U. a. folgende
wichtige Planungsgrundlagen sind maßgeblich in den Änderungsentwurf eingeflossen:
o Die Bevölkerungsprognose des im Auftrag des
Landkreises Lüneburg erstellten Gutachtens des Instituts für
Entwicklungsforschung und Strukturplanung aus 2005,
o das Kreisentwicklungskonzept aus 2007,
o das Regionale Entwicklungskonzept (REK 2000)
für die Metropolregion Hamburg,
o Entwicklungskonzepte der Gemeinden und
Samtgemeinden,
o
Rahmenkonzept
zur Erweiterung des Naturparks Lüneburger Heide sowie
o
Tourismuskonzept
Elbe der Metropolregion Hamburg
Die Verwaltung hat sich von einem
kooperativen, auf größtmöglichen Konsens angelegten Planungsprozess leiten
lassen, um das fortzuschreibende RROP auf eine breite Basis zu stellen. Aus
diesem Grund sind insbesondere die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden als die
wichtigsten Adressaten der überörtlichen Planung informell und sehr frühzeitig
in den Planungsprozess eingebunden worden. So wurden sie bereits mit Schreiben
vom 06.05.08 gebeten, orientiert an den allgemeinen Planungsabsichten des Landkreises,
ihre eigenen Zielvorstellungen für eine örtliche und überörtliche Entwicklung
unserer Region und ihrer Teilräume darzulegen. Die daraus resultierenden
Positionen wurden anschließend ausführlich mit den Kommunen erörtert. Dabei
konnte ein hohes Maß an Übereinstimmung erzielt werden, ohne dass dabei eine
konzeptionelle, ganzheitliche Ausrichtung des RROP eingebüßt worden wäre.
Weitere informelle Abstimmungen wurden
vorgenommen mit
o
den
Nachbarkreisen,
o
denjenigen
Trägern öffentlicher Belange und anerkannten Naturschutzverbänden, die sich in
wesentlicher Weise zu den Planungsabsichten geäußert hatten.
Auf einige neue oder ergänzte Festlegungen
soll nachfolgend schlaglichtartig eingegangen werden, die für die Neuausrichtung
bestimmend sind. Sie sind abgeleitet aus grundlegenden Leitlinien und
Erfordernissen zur räumlichen Entwicklung des Kreisgebietes wie
o
den
Herausforderungen des demografischen Wandels und der Frage, wie sich unter geänderten
und sich weiter ändernden Bedingungen die Daseinsvorsorge in allen Teilen des
Kreisgebietes nachhaltig aufrecht erhalten oder möglichst stärken lässt,
o
dem
Ziel, die räumlichen Rahmenbedingungen für eine innovative wirtschaftliche
Entwicklung zu schaffen und dabei die Entwicklungsunterschiede zwischen den
westlichen und den östlichen Teilräumen abzumildern,
o
den
Herausforderungen des Klimawandels sowie
o
der
Absicht, die Siedlungsentwicklung behutsam zu gestalten und Freiraumpotenziale
zu schonen.
Wie
wollen wir diese Ziele erreichen?
o
Das
bisher schon enthaltende Prinzip eines gestuften Systems von zentralen Orten
wird gestärkt, durch Orte mit grund- oder mittelzentralen Teilfunktionen
ergänzt und durch konkretere Festlegungen auf eine für alle Beteiligten
verlässliche Basis gestellt. Dies ist ein wesentlicher Baustein, um auch
künftig die Daseinsvorsorge kosteneffektiv und umweltfreundlich sicherzustellen
und Siedlungsflächen ressourcenschonend auszuweisen.
o
Ausgehend
von spezifischen „Begabungen“ sollen Stärken gestärkt werden, indem
jeweils unterschiedliche Entwicklungsaufgaben für einzelne Orte festgelegt
werden. Dies gilt sowohl für große Kommunen wie Lüneburg, wo der
Hochschulstandort durch die Entwicklungsaufgabe „wissenschaftliche Forschung
und Lehre“ gestärkt werden soll. Gleichermaßen sollen aber auch kleinere
Orte ihre Potenziale noch besser entfalten können und raumordnerisch darin
unterstützt werden. Stellvertretend für viele seien hier genannt die
Präsentation archäologischer Stätten in Rullstorf oder das
Wolfsinformationszentrum in Neuhaus.
o
Die
besonderen, landschaftsräumlich oder baukulturell geprägten Ausstattungen
einzelner Teilräume oder Orte sollen noch stärker für die weitere Entwicklung
des Tourismus unterstützt werden. Beispielhaft genannt seien hier das
Touristische und Reitzentrum Luhmühlen oder die Entwicklung eines
technikorientierten Tourismusschwerpunktes in Embsen/Melbeck, der natur- und
erlebnisorientierte Tourismus in der Lüneburger Heide oder der auf Wasser,
Flussaue und Radwandern ausgerichtete Fremdenverkehr in der Elbtalaue.
o
Der
Stärkung von „klassischen“ Standortfaktoren dient die
Schwerpunktsetzung bei gewerblichen Standorten, bei denen solche mit einer
erstklassigen Verkehrsanbindung besonders hervorgehoben werden.
o
Der
geforderte Neubau des Schiffshebewerks und die Schaffung eines Logistikknotens
im Osten Lüneburgs dienen der Verbesserung von Standortfaktoren für den
Transportsektor und die gewerbliche Wirtschaft.
Die
Entwicklungsziele hat die Verwaltung, ausgehend von der informellen Beteiligung
und ergänzt durch eigene Vorstellungen, den Hauptverwaltungsbeamten in einer
Sitzung am 13.03.09 vorgestellt und eingehend mit einem hohen Maß an
Übereinstimmung erörtert.
Es
gilt, angesichts des bisher nahezu ungebremsten Flächenverbrauchs, mit
natürlichen Ressourcen zukünftig gemeinsam sorgsamer umzugehen. Hierzu wird
vorgeschlagen,
o
die
jährliche Flächenverbrauchsrate für Wohnflächen, gemessen am durchschnittlichen
Verbrauch der Jahre 2004 bis 2006, auf 50% bis 2020 zu senken,
o
verstärkt
auf Innenentwicklung zu setzen und
o
die
Siedlungsentwicklung in nicht-zentralen Orten auf Eigenentwicklung zu
beschränken.
Damit
sollen zum einen Ressourcen geschont, zum anderen aber auch das Wohnumfeld für
die hier lebenden Menschen wie gleichermaßen die Attraktivität unseres Raumes
für Gäste gesichert und gestärkt werden. Zersiedelungstendenzen, wie wir sie in
einigen Teilräumen zu beklagen hatten, sollen dadurch gestoppt werden.
Diese Zielsetzungen hat die Verwaltung im November
2008 vor zahlreichen Gästen aus Verwaltung, Planung, Verbänden und Politik,
unterstützt durch Sachverstand aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert. Die
Gedanken sind dort auf durchweg fruchtbaren Boden gefallen.
Um
die Mobilität der Bevölkerung aufrecht zu erhalten, die daraus resultierenden
Belastungen für die Bevölkerung oder die natürlichen Ressourcen zu verringern,
gleichzeitig aber die entstehenden Verkehrsströme zu minimieren und in einem
möglichst hohem Maße auf umwelt- und klimafreundliche Verkehrsmittel
umzulenken, wurden eine Reihe von Festlegungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur
getroffen. Diese beziehen sich auf
o
eine
Stärkung des Personen- wie des Güter-Schienenverkehrs (z.B. Taktverdichtung auf
der Bahnstrecke Lüneburg-Hamburg),
o
Ortsumgehungen
im Zuge der B 216,
o
verkehrsentlastende
Maßnahmen nördlich und westlich von Lüneburg,
o
eine
Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im
Umland des Oberzentrums sowie
o
die
bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel untereinander, so auch die Verknüpfung
zwischen Fahrrad und Bahn.
Diese
Maßnahmen sind aus einem integrierten Verkehrskonzept für den Landkreis
Lüneburg abgeleitet, das von der Planungsgemeinschaft Dr. Theine, Hannover,
erarbeitet wurde. Es liegt als Anlage 3 bei und wird vom Gutachter in
der Sitzung näher vorgestellt. Diese Arbeit wurde in einem intensiven
Abstimmungsprozess u. a. von Vertretern der Kommunen begleitet.
Wie
geht es weiter?
o Im Laufe des Sommers werden förmlich
beteiligt die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, die öffentlichen Stellen,
die Nachbarkreise sowie die anerkannten Verbände, soweit sie von der Planung
betroffen sein können.
o Gleichzeitig wird auch die Öffentlichkeit
beteiligt.
o Danach sind die Anregungen und Bedenken
– soweit solche vorgebracht worden sind - mit den Kommunen, den
Nachbarkreisen und den anerkannten Verbänden in einem Termin zu erörtern. Dies
wird ggf. im Spätherbst dieses Jahres geschehen.
o Sofern in diesem Erörterungstermin Bedenken
oder Anregungen nicht ausgeräumt werden können, wird die Verwaltung diese
prüfen, ob und inwieweit sie berücksichtigt werden sollen.
o Das Ergebnis wird dem Raumordnungsausschuss
– voraussichtlich gegen Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres –
vorgelegt.
o Bleibt der Entwurf im Wesentlichen
unverändert, kann er nach Beratung im Raumordnungsausschuss und im
Kreisausschuss im Frühjahr 2010 als Satzung beschlossen und danach
o der Regierungsvertretung zur Genehmigung
vorgelegt werden. Diese hat binnen 3 Monaten über die Genehmigung zu
entscheiden.
o Nach Genehmigung kann dann das geänderte
Raumordnungsprogramm im Sommer 2010 in Kraft treten.
Falls auf Beschluss
des Raumordnungsausschuss aufgrund von zu berücksichtigen Anregungen und Bedenken
der Entwurf in seinen Grundzügen geändert werden sollte, müsste eine erneute
Beteiligung durchgeführt werden. Diese kann allerdings auf die geänderten Teile
beschränkt werden.
Für diesen Fall
würde sich das Verfahren um etwa 3 Monate verschieben.
Hinweis:
Das LROP kann im
Internet unter www.ml.niedersachsen.de
(Themen/Raumordnung und Landesentwicklung/ Landesraumordnungsprogramm)
abgerufen werden.
Beim RROP 2003 geht
die Verwaltung davon aus, dass es den Kreistagsabgeordneten vorliegt.
Den Vorsitzenden der
Kreistagsfraktionen wird jeein Exemplar des LROP und des RROP 2003 zugesandt.
Darüber hinaus liegt jeweils ein Exemplar dieser Programme im Kreistagsbüro zur
Ansicht bereit.
Anlagen:
- Entwurf RROP Fortschreibung 2009 (Ziele
in Fettdruck dargestellt)
- Umweltbericht
- Integriertes Verkehrskonzept
- Gegenüberstellung textliche Festlegungen RROP
2003/RROP 2009
- Gegenüberstellung zeichnerische Festlegungen
RROP 2003/RROP 2009